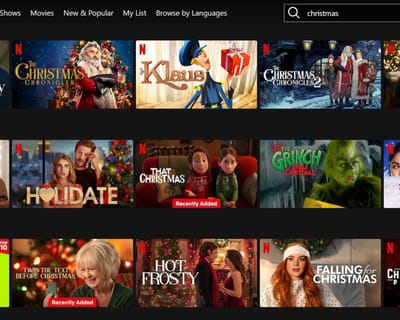Gewalt gegen Frauen
Zweifach unsichtbar: Zwangssterilisation bei Frauen mit Behinderungen
Die derzeitigen Gewaltschutz-Pakete schützen Frauen mit Behinderung zu wenig. Ihre Belange kommen kaum vor. Sichtbar wird das beim Thema Zwangssterilisation.
„Geh, lass dich unterbinden. Du kannst eh nimmer g’scheit.“ – „Ich wollte nicht. Aber die haben mich so gedrängt, bis ich mitgetan hab.“ Interviews mit Frauen mit Lernschwierigkeiten wie diese, die Gertraud Kremsner 2017 als Teil einer Studie durchführte, erreichen nur selten eine breite Öffentlichkeit. Auch eine umfangreiche Bekämpfung des geschilderten Problems – Zwangssterilisation bei Frauen mit Behinderung – bleibt aus.
Im EU-Gewaltschutzpaket, das im Februar beschlossen wurde, konnte man sich nicht auf das EU-weite Verbot für Zwangssterilisation einigen. Dabei ist Gewaltbetroffenheit bei Frauen mit Behinderungen alles andere als ein Nischenthema: Laut einer deutschen Studie sind jene zwei bis dreimal häufiger von Gewalt betroffen als Frauen ohne Behinderung.
Österreich wird für sein Gewaltschutzgesetz international zwar immer wieder gelobt, zuletzt etwa im GREVIO-Bericht, der die Umsetzung der Istanbul-Konvention durch die österreichische Regierung bewertet. Für Frauen mit Behinderungen ergeben sich aber laut Bericht noch immer Barrieren im Zugang zu Opferschutz wie etwa zu Frauenhäusern. Gerade bei Gewaltformen, die vor allem Frauen mit Behinderungen und weniger Frauen ohne Behinderungen betreffen, zeigen sich Lücken im Gewaltschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen mit Behinderung einer Sterilisation unterziehen, ist laut Deutschem Institut für Menschenrechte achtmal höher als bei Frauen ohne Behinderungen. Diese Zahlen gelten für Deutschland, für Österreich gibt es im Moment keine vergleichbaren Erhebungen.
Status quo in Österreich
Bei Frauen mit Erwachsenenvertretung – das betrifft oft Frauen mit Lernschwierigkeiten – muss seit 2001 in Österreich ein Gericht im Falle einer Sterilisation einwilligen. Zudem muss die betroffene Frau in dem Verfahren von einem besonderen Rechtsbeistand vertreten werden, seit 2018 verpflichtend durch einen Erwachsenenschutz-Verein. Diese Aufgabe übernimmt das VertretungsNetz, eine von vier solcher Organisationen in Österreich.
Doch Martin Marlovits, stellvertretender Fachbereichsleiter Erwachsenenvertretung von VertretungsNetz, berichtet von oberflächlichen, sich ähnelnden Gutachten, teilweise sogar mit Copy-Paste-Fehlern und von Psychiater*innen ohne Expertise für Lernschwierigkeiten. „Oft wird in einer Sprache kommuniziert, die nicht verständlich ist. Gerade bei Trisomie21 wird in der Regel vorschnell attestiert, dass die Entscheidungsfähigkeit fehlt.“ Hier sollten die Gerichte nachschärfen und ihren Expert*innenpool erweitern. Marlovits glaubt, dass die wenigen Fälle, die der Verein vor Gericht vertritt, nur die Spitze des Eisbergs sind: „Wir sehen weniger, als wirklich passiert“.
Gerade in ländlichen Regionen könne man davon ausgehen, dass Ärzt*innen Sterilisationen durchführen, ohne das Gericht zu informieren, teils schlicht aus Unwissenheit über die Rechtslage. Kontrolliert wird das von niemandem. Der UN-Fachausschuss sieht hier dringenden Schulungsbedarf für Ärzt*innen und eine Erfassung valider Zahlen.
Hohe Dunkelziffer
Auch der Monitoringausschuss, der die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich kontrolliert, geht von einer großen Dunkelziffer aus. Selbst wenn eine Betroffene vermeintlich der Sterilisation zugestimmt hat, steht dahinter häufig der emotionale Druck von Angehörigen oder Betreuungspersonen und die Drohung, Unterstützung zu entziehen. Auch fehlende Förderung führt dazu, dass Frauen mit Lernschwierigkeiten ihre Bedürfnisse oft nicht klar äußern können.
Das Ziel dieser Druckausübung ist, einer möglichen Schwangerschaft vorzubeugen. Außerdem ermöglicht diese reproduktive Kontrolle eine weitere Gewaltform: Wenn Frauen sterilisiert sind, bleibt auch sexualisierte Gewalt eher unsichtbar. Das schützt Täter*innen.
Nur fünf der 28 betroffenen Personen wollten den Eingriff.
Die Erfahrungen der Expert*innen decken sich mit den Ergebnissen einer Studie des Sozialministeriums zu Gewalterfahrungen in Behinderteneinrichtungen von 2019: Vor allem Frauen (17 Prozent der Befragten) berichten von eigenen Sterilisationen, Männer seltener (6 Prozent). Nur fünf der 28 betroffenen Personen wollten den Eingriff. Häufig wurde ihnen die Sterilisation von Eltern, Betreuer*innen oder Ärzt*innen nahegelegt. Zwei Personen sprachen explizit von Zwang.
Eugenische Kontinuitäten
Ein klassischer Fall zur Veranschaulichung: Die Tochter verliebt sich in der Werkstätte oder im Heim in einen Mitbewohner oder Kollegen. Die Eltern vermuten, dass es zu sexuellen Handlungen kommt und fürchten sich vor einer eventuellen Schwangerschaft. „Sie handeln vermutlich nicht mit schlechter Absicht und sorgen sich, dass ihre Tochter mit einem Kind überfordert sein könnte“, erklärt Marlovits.
„Viele Menschen mit Behinderungen dürfen nicht das Leben einer erwachsenen Person führen, obwohl sie es schon lange sind.“ Christine Steger, Behindertenanwältin
Gerade in dieser Form des Handelns „im besten Interesse“ sehen die Expert*innen eine tief verwurzelte Problematik. „Viele Menschen mit Behinderungen dürfen nicht das Leben einer erwachsenen Person führen, obwohl sie es schon lange sind“, sagt Behindertenanwältin Christine Steger. Das zeige sich gerade, wenn sie in Institutionen leben. Sex haben, in einer Beziehung sein, Kinder kriegen? „Es ist schon so normal, dass Menschen mit Behinderungen nicht entscheiden können, wann sie essen oder mit wem sie wohnen“, sagt Steger. Die gesellschaftliche Botschaft sei klar: „Menschen mit Behinderungen sollen sich nicht reproduzieren und möglichst kind-ähnlich leben. Sie müssen in einem institutionellen Rahmen verwaltbar sein.“
Dazu wird auch die Verabreichung von Verhütungsmitteln genutzt. „Wenn bei Verhütungsmethoden wie einem Implantat oder einer Dreimonatsspritze die Regelblutung ausbleibt, ist das auch praktisch für die Pflege“, merkt Steger kritisch an. Eine Erhebung der Volksanwaltschaft ergab, dass Empfängnisverhütung in 20 Prozent der untersuchten Einrichtungen nicht immer selbstbestimmt erfolgt. Auch die Beratungsstelle Ninlil kann das für Frauen mit Lernschwierigkeiten bestätigen. Die Volksanwaltschaft fordert die Unterlassung von Zwangsverhütung und sieht einen Bedarf für sexualpädagogisch geschulte Fachkräfte.
„Die eugenischen Ideen der NS-Zeit haben nicht einfach 1945 aufgehört. Viele Ärzt*innen sind nie belangt worden.“ Christine Steger, Behindertenanwältin
Reproduktive Kontrolle von Frauen mit Behinderungen verstößt nicht nur gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, sondern muss laut Steger, die auch im Bundesvorstand des KZ-Verbandes ist, als historische Kontinuität verstanden und aufgearbeitet werden. Im NS-Regime wurden Menschen mit Behinderungen deportiert, für medizinische Versuche missbraucht und im Rahmen der Aktion T4 auch systematisch ermordet: „Die eugenischen Ideen der NS-Zeit haben nicht einfach 1945 aufgehört. Viele Ärzt*innen sind nie belangt worden.“ Das zeige sich bis heute in der prekären Gesundheitsversorgung für behinderte Personen.
„Ich lasse mich nicht drängen, auch wenn das besorgte Eltern immer wieder probieren.“ Daniela Dörfler, Gynäkologin
Die Krisenambulanz im Wiener AKH ist ein Beispiel dafür, wie Ärzt*innen es besser machen können. Hier betreut die Gynäkologin Daniela Dörfler Patient*innen, deren Bedürfnisse in niedergelassenen Arztpraxen nicht gedeckt werden. Sie erklärt in einfacher Sprache und nimmt sich viel Zeit, um Vertrauen mit den Frauen mit Lernschwierigkeiten für die gynäkologische Untersuchung aufzubauen und herauszufinden, was sie wirklich wollen: „Ich lasse mich nicht drängen, auch wenn das besorgte Eltern immer wieder probieren.“ Dörfler klärt auch immer ab, ob die Frau mit Begleitperson oder lieber allein untersucht werden möchte: „Ich will auch wissen, wer sie begleitet und in welcher Beziehung sie zueinander stehen.“
Eine wichtige Maßnahme gegen Gewalt an Frauen mit Behinderungen, die Geschäftsführerin Elisabeth Udl von Ninlil immer wieder in Interviews anführt, ist mehr Offenheit für das Thema, damit Betroffene wissen, dass sie darüber sprechen können. Hier könnten Medien eine dringend benötigte Öffentlichkeit schaffen. Bislang ist das Thema in der medialen Berichterstattung zweifach unsichtbar.
Zum einen wird geschlechtsspezifische Gewalt häufig nur aufgegriffen, wenn sie in einem Femizid gipfelt. Die zahlreichen Formen von alltäglicher Gewalt, die einem Femizid vorausgehen, bleiben meist unbeleuchtet. Zum anderen erhält die alltägliche Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen kaum mediale Aufmerksamkeit. Wenn doch, dann häufig in klischeehaften Rollen: als „bewundernswerte Held*innen“, die „trotz Behinderung“ Großes wie Behindertensport leisten, oder als „bemitleidenswerte Bittsteller*innen“ in Charity-Sendungen wie Licht ins Dunkel. Diese Stereotype lassen wenig Platz für Berichte über den Alltag mit Behinderung.
💡
Tipps für die Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen kann man sich bei den
Leidmedien und
andererseits holen. Anhaltspunkte für die Darstellung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen mit Behinderung, schafft auch die
UN-Behindertenrechtskonvention.
Für Frauen mit Behinderung ist das besonders gravierend. Eine österreichische Studie zur Inklusion in den Medien von 2021/22 zeigt, dass Frauen mit Behinderung seltener in der Berichterstattung vorkommen als Männer mit Behinderung. Ihr Anteil sank sogar von 42 Prozent (2015/16) auf 32 Prozent (2021/22). Dieser Rückgang ist auf die intensive Beleuchtung des Unfalls der Hochspringerin Kira Grünberg 2016 zurückzuführen. Zieht man jene Berichte ab, ergibt sich zwar eine quantitative Zunahme in der Berichterstattung über Frauen, von einer qualitativen Verbesserung kann jedoch keine Rede sein.
Mehr Alltag, weniger Einzelschicksal
Die Fokussierung auf Einzelschicksale vernachlässigt die dahinter liegenden strukturellen Gründe und schafft eine Schieflage, wie der Wissenschaftler Matthias Vollbracht am Beispiel beruflicher Inklusion erklärt. Weil in der Berichterstattung etwa ein Fokus auf besonders erfolgreichen Einzelpersonen liegt, entsteht der Eindruck, berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen laufe gut. Die Realität sieht anders aus. Maria Pernegger, die Autorin der Studie Menschen mit Behinderung und Inklusion in österreichischen Massenmedien sieht das ähnlich: „So entsteht kein Abbild der Realität, sondern vielmehr eine verzerrte Konstruktion und Teilwirklichkeit, die Inklusion im Weg stehen kann.“
Für das Thema Gewaltbetroffenheit bedeutet das: Wir brauchen mehr Berichterstattung über alltägliche Formen von patriarchaler und ableistischer Gewalt und mehr Einblicke in die Lebensumstände von Frauen mit Behinderungen. Ein markantes Beispiel für deren Betroffenheit von Gewalt ist etwa die oben beschriebene reproduktive Kontrolle durch Institutionen, Ärzt*innen und die eigene Familie.
Ableismus ist ein System von Denk- und Verhaltensweisen, das Menschen und deren Körper nach Leistungsfähigkeit bewertet. Nichtbehinderte Körper werden zur Norm erklärt und Körper, die davon abweichen als „die anderen“ ausgeschlossen.
Dass Gewaltberichterstattung davon profitiert, wenn Frauen mit Behinderungen selbst Teil von Redaktionen sind, hat zuletzt etwa die Recherche zu sexualisierter Gewalt des inklusiven Mediums andererseits gezeigt. Um es mit den Worten der behinderten Journalistin und Autorin Andrea Schöne zu sagen: die Berichterstattung über behinderte Menschen braucht einen Perspektivwechsel und nichtbehinderte Journalist*innen müssen anfangen, ihren eigenen Ableismus zu hinterfragen.
Eva Rottensteiner ist freie Journalistin. Sie hat einen Bachelor in Kommunikationswissenschaft und studiert aktuell Politikwissenschaft und Gender Studies. Politisch engagiert sie sich in Selbstvertretungsgruppen für Frauen mit Behinderungen.