
Mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit hast du heute, an dem Tag, an dem du diesen Text liest, schon den Dienst eines US-amerikanischen Big-Tech-Unternehmens genutzt. Möglicherweise war dir das bewusst, vielleicht hast du sogar aktiv darüber nachgedacht, wahrscheinlich war es aber einfach Routine. Wer heutzutage das Internet verwendet, begibt sich fast immer in die Fänge der Tech-Bros aus dem Silicon Valley, sei es mit den eigenen Daten, der Aufmerksamkeit oder gar dem eigenen Geld.
Auch der Journalismus kann dem Silicon Valley nicht entkommen. Das International Journalism Festival in Perugia, Italien, ist eine der wichtigsten Journalismuskonferenzen weltweit – und wurde dieses Jahr unter anderem von Google, Microsoft und you.com (einem KI-Startup) finanziert. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, alle Sessions werden live auf Youtube ausgestrahlt, im Gegenzug gibt es von Unternehmen gesponserte Panels und überästhetisierte Werbevideos zwischen den Programmpunkten.
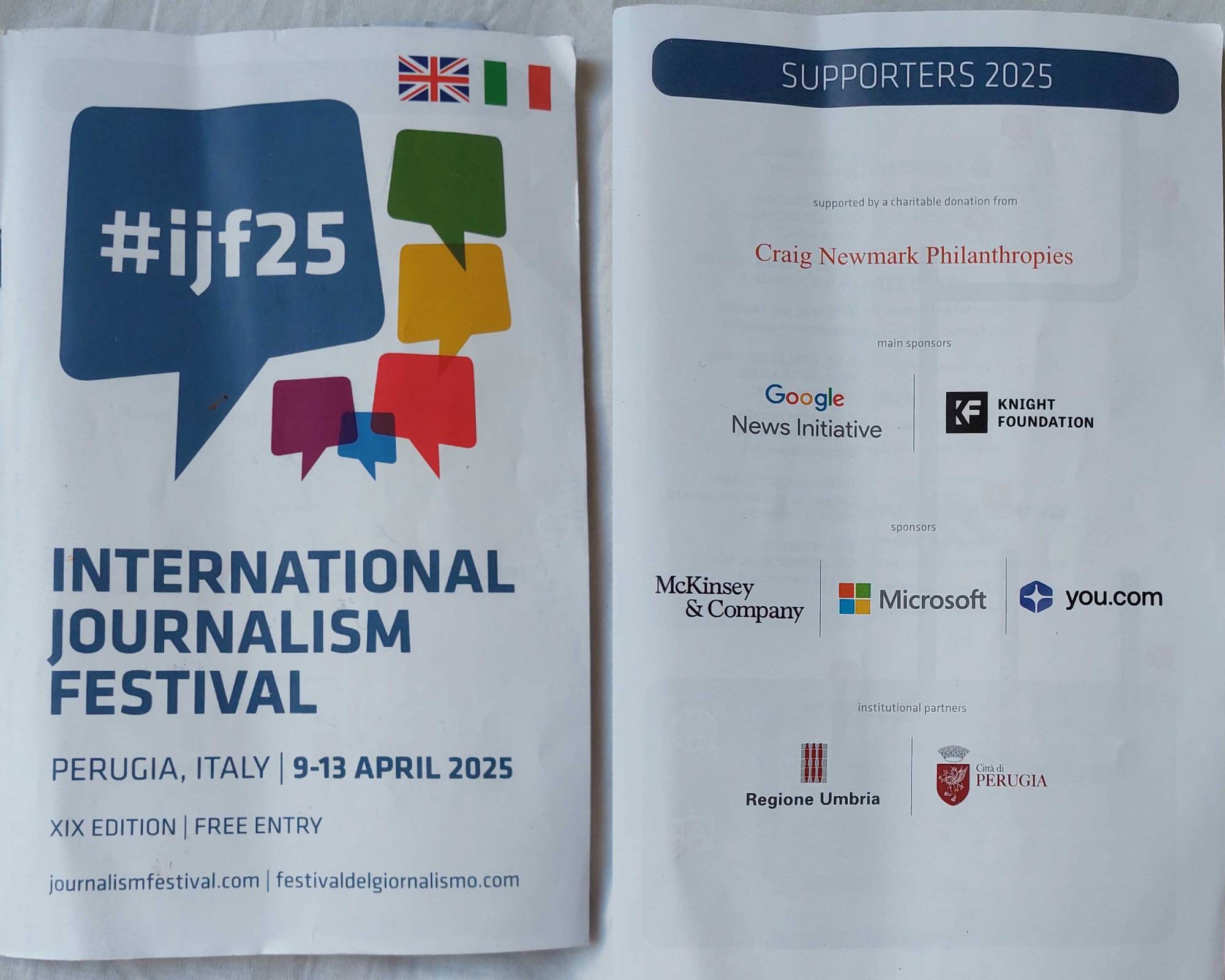
Big Tech sitzt also auch mit am Tisch, wenn die wichtigsten Leute der Medienbranche aus der ganzen Welt in Perugia über die Zukunft und Herausforderungen des Journalismus im 21. Jahrhundert sprechen. Gleichzeitig haben sich dort heuer einmal mehr unzählige Journalist*innen, Wissenschaftler*innen und Whistleblower*innen gegen den großen politischen und gesellschaftlichen Einfluss der Techkonzerne ausgesprochen.
Es ist Zeit, aufzuwachen und das Thema endlich ernst zu nehmen. Das ist die wohl wichtigste Botschaft der verschiedensten Panels, die es heuer rund um Big Tech und den Journalismus in Perugia gab. Bereits am Donnerstagvormittag wurde mit der Session Captured: how Silicon Valley's AI emperors are reshaping reality der Rahmen abgesteckt, in dem sich diese Kritik bewegen sollte.
Der Fokus dieser Session lag auf dem gleichnamigen Podcast des amerikanischen Medien-Startups Coda Story. Für „Captured“ haben sich Christopher Wylie, einer der Whistleblower von Cambridge Analytica und selbsternannter Techbro, und die Coda-Journalistin Isobel Cockerell im Rahmen einer einjährigen Recherche in das Universum des Silicon Valleys begeben – und aufrüttelnde Erfahrungen gemacht.
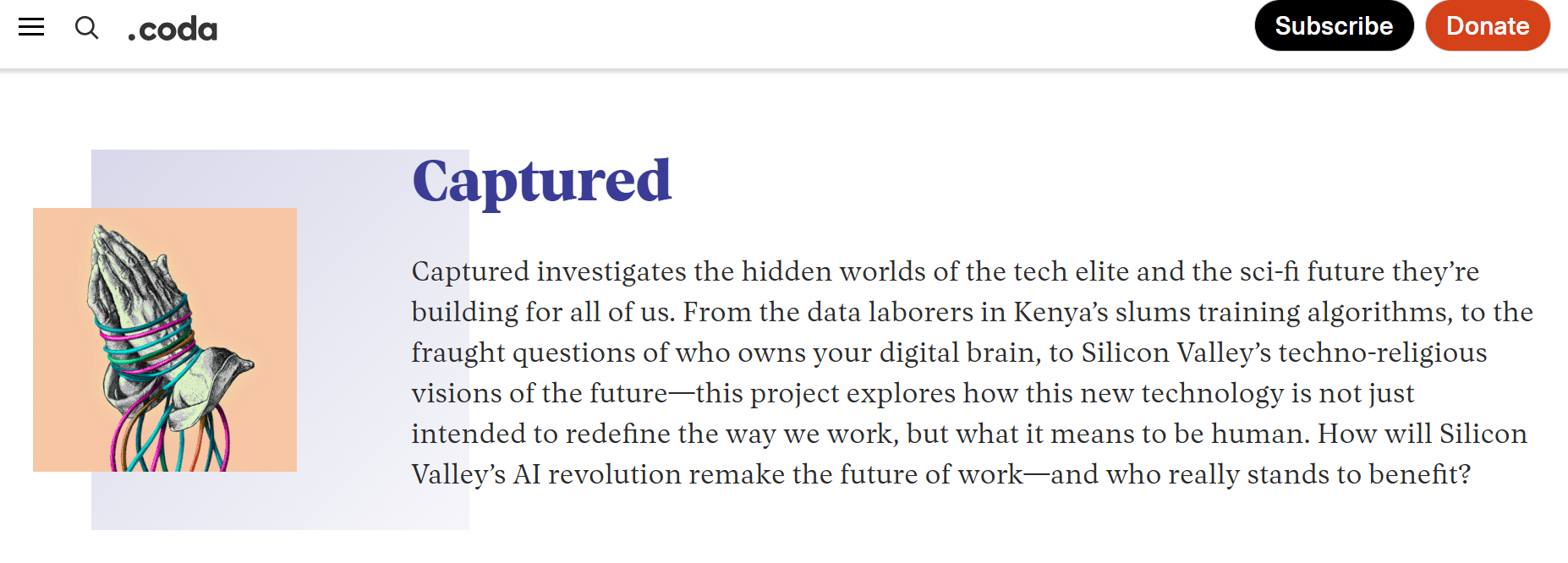
Ihr Fazit: Wir haben es mit einem Kult, einer faschistischen religionsähnlichen Ideologie zu tun, die dringend gestoppt werden muss: „This is not tech, this is abuse of power“, Missbrauch der Macht. Und: Journalist*innen sollten endlich beginnen, das auch so zu benennen und es ernst zu nehmen, wenn diese mächtigen Tech-Männer, wie Peter Thiel oder Elon Musk, sagen, dass sie mit ihrer Technologie die Menschheit ersetzen wollen. „This is an Anti-Human-Ideology, you have to take it seriously,“ forderte Wylie in einem durchaus emotionalen Ausbruch, der von der Panel-Moderatorin Natalia Antelava, der Co-Gründerin von Coda Story, kaum einzufangen war.
Zum Abschluss wurde dann ein QR-Code eingeblendet mit einem direkten Link zum Podcast und der begleitenden Berichterstattung von Coda Story. Etwas paradox: Captured gibt es exklusiv zu hören auf Audible, der Audioplattform von Amazon.
Weniger ambivalent war das Workshop-Panel AI Tools for Journalists. Es wurde direkt von der Google News Initiative organisiert. Der Speaker war Etan Horowitz, ein für News Partnerships zuständiger Google-Mitarbeiter. Die rund 45 Minuten waren eine werbliche Einführung in die verschiedenen Google-KI-Anwendungen und wie sie im Journalismus verwendet werden können. Auch viele andere Panels drehten sich um die Frage, wie nützlich KI für den Journalismus ist und wie sie verantwortungsbewusst eingesetzt werden kann. Auch auf dem vom KI-Startup You.com direkt gesponserten Panel Journalism in the age of AI: agents, answers and accuracy wurde dieses Thema umfangreich diskutiert.
Tatsächlich gibt es für Künstliche Intelligenz insbesondere in kleinen, flexiblen Medienunternehmen sehr viele praktische Anwendungsmöglichkeiten. Aber auch in großen Medien, wie der Financial Times, werden bereits umfangreich KI-Anwendungen implementiert, einen Showcase liefert die Session How the Financial Times is using AI. Interessant ist vor allem das Ausmaß, in dem KI bereits Einzug in die tägliche Arbeit von Journalist*innen auf der ganzen Welt gefunden hat.
Kritik daran, wie diese KI-Systeme entwickelt wurden, so wie sie in Perugia sonst häufig geäußert wurde, war auf diesen Panels kaum präsent: Die umfangreichen Urheberrechtsverletzungen, die für das Training von Künstlicher Intelligenz in Kauf genommen wurden, kamen nicht wirklich vor. Auch eine Thematisierung der unfassbaren Ausbeutung von Menschen aus dem globalen Süden, die die Basis von ChatGPT und Co. bildet, suchte man dort vergebens.
Dass diese Unternehmen oftmals skrupellos im Umgang mit rechtlichen Rahmenbedingungen und Gesetzen sind, überrascht nicht. Welche Vorkehrungen aber notwendig sind, wenn man sich ihnen journalistisch nähert, ist schlichtweg erschreckend. Auf dem Panel When removing bylines isn’t enough: how can journalists safely investigate tech in 2025? erzählte unter anderem die Investigativjournalistin Karen Hao von ihren Erfahrungen mit Big Tech.
Hao berichtete etwa davon, dass sie aufgrund ihrer bisherigen Arbeit von all diesen Unternehmen „geblacklistet“ sei, also keinerlei Informationen mehr von ihnen bekommt und auch niemand aus den Unternehmen mit ihr sprechen will. Sie habe außerdem ihre gesamte öffentliche Social-Media-Präsenz komplett zurückgefahren und mit ihrem Ehemann die Übereinkunft getroffen, sich niemals öffentlich gemeinsam zu zeigen. Außerdem legt sie ein großes Augenmerk darauf, so selten wie möglich Dienste der Big-Tech-Unternehmen zu verwenden, über die sie investigativ berichtet.
All das tut sie, um so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten, sollten sich diese Unternehmen doch einmal mit Aktionen gegen sie persönlich richten wollen. Hao hat bisher glücklicherweise noch keine juristischen Drohungen erhalten. Für ihr neues Buch Empire of AI hat sie sich in die Machenschaften des wohl wichtigsten KI-Unternehmens Open AI gestürzt. Es erscheint am 20. Mai bei Penguin Random House.

Eine andere Journalistin, die bereits Erfahrungen mit einer sogenannten SLAPP-Klage („Strategic lawsuit against public participation“) machen musste, ist Carole Cadwalladr. Die bekannte Guardian-Journalistin war Teil des Panels Telling big tales on big tech with big data und nahm sich bei ihrer Analyse kein Blatt vor dem Mund: „We in the media need to treat some politicians and tech people like natural disasters, like we would treat a hurricane.“ – „Als Journalist*innen müssen wir diese Politiker und Tech-People behandeln wie Naturkatastrophen.“ Und: Berichterstattung über Big Tech und Big Data solle nicht mehr separat von politischer Berichterstattung stattfinden, denn diese Unternehmen seien jetzt auf einer Linie mit einem Autokraten (gemeint ist US-Präsident Donald Trump).
Cadwalladr, die unter anderem an der Aufdeckung des Cambridge-Analytica-Skandals beteiligt war, wurde 2019 von einem britischen Unternehmer verklagt, weil sie ihn bei einem TED-Talk und in zwei Tweets in die Nähe von Russland gerückt hat. Dieses Verfahren hätte beinahe ihre Existenz vernichtet.
Die Diskussion über Regulierung und Gesetze zu AI und Big Tech geht für Cadwalladr am Thema vorbei: „Wir haben Regulierungen und Gesetze. Das, was diese Unternehmen mit unseren Daten machen, ist illegal. Aber zu dem Zeitpunkt, wo jemand Urheberrechtsgesetze einklagen kann, ist es zu spät. Die KI-Modelle sind trainiert, die KI ist draußen. Diese Silicon-Valley-Methode, Gesetze zu brechen und damit davon zu kommen, wurde jetzt auch in der mächtigsten Regierung der Welt implementiert.“
Cadwalladr glaubt, dass Regulierungen und Gesetze uns deshalb nicht helfen werden, stattdessen brauche es Aufmerksamkeit auf das Thema in der Öffentlichkeit und eine Veränderung der Wahrnehmung darüber, wie massiv die Bedrohung von Big Tech ist: „Wir müssen anfangen diese Unternehmen, wie unsere Feinde zu behandeln.“
Das sieht auch Martin Andree so. Der deutsche Medienwissenschaftler glaubt, dass das Fenster, in dem wir noch handeln können, sich schnell schließt. Im Vortrag How to save journalism from big tech kritisiert er die Monopolbildung am digitalen Plattformmarkt und sieht darin eine massive Bedrohung für die Demokratie: „Medienmonopole sind die perfekten Voraussetzungen für Autokraten, weil wenn sie die Monopole kontrollieren, kontrollieren sie alles. Deshalb sind Medienmonopole in einer Demokratie eigentlich nicht möglich – Demokratie bedeutet Pluralismus.“

Wie seine Mitstreiter*innen in Perugia kritisiert auch Andree, dass es kaum eine Debatte über diese Monopole am digitalen Medienmarkt und ihren Einfluss auf die Pressefreiheit gibt, obwohl immer wieder über Medien- und Pressefreiheit diskutiert wird. Für ihn ist das Wort Regulierung nicht das richtige Framing: „Diese Oligarchen haben uns das freie Internet weggenommen, deshalb kann es gar nicht um Regulierung gehen, es geht um die Befreiung des digitalen Marktes von diesen demokratiefeindlichen Monopolen.“
Andree fordert eine Reihe von Maßnahmen, um unsere Demokratien und die freien Medien zu retten. Das sei sogar recht einfach umsetzbar, wie er im Interview mit tag eins skizziert. Er habe allerdings nicht viel Hoffnung für die Zukunft, das lässt er eindrücklich durchblicken.

Immerhin gibt es jetzt Schritte in die richtige Richtung. Am Montag – just drei Tage nach dem Vortrag von Andree in Perugia – startete in Washington DC ein Kartellverfahren zur Zerschlagung von Meta, dem Konzern hinter Facebook, Whatsapp und Instagram. Der Vorwurf der US-Wettbewerbsbehörde FTC: Meta habe durch die Übernahme von Whatsapp und Instagram ein Monopol gebildet und „die Verbraucher hätten keine vernünftigen Alternativen, an die sie sich wenden können.“
Ein endgültige Entscheidung in diesem Prozess könnte sich über Jahre hinweg ziehen – wie sich die Trump-Regierung in Bezug auf diesen Fall verhalten wird, ist unklar. Klar ist nur, unser aller Umgang mit den neuen Technologien ist so politisch wie noch nie.
Disclaimer: Die Reise nach Perugia wurde ermöglicht vom FJUM und der Wirtschaftsagentur Wien.
Nur mit deiner Unterstützung, deinem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag, können wir unabhängig recherchieren und sorgfältigen Journalismus machen.
Jetzt Mitglied werden