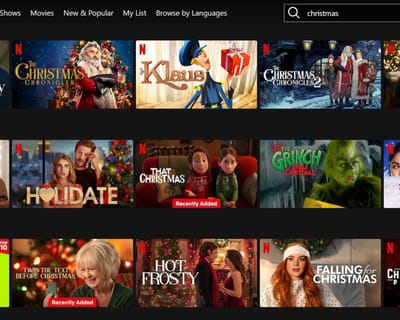Sichtbar für einen Tag
Zum Welt-Down-Syndrom-Tag steigen jedes Jahr die Medienanfragen zum Thema. Doch das Interesse ist flüchtig, ebenso wie bei anderen Gedenktagen. Was fehlt, ist Tiefe, Nachhaltigkeit – und Empathie.
Alle Jahre wieder: Im März laufen die Telefone bei Down-Syndrom Österreich heiß. Zum Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März gäbe es einen großen „Medien-Hype“, sagt Sylvia Andrich, Obfrau des Vereins, der sich für die Belange von Menschen mit Down-Syndrom einsetzt: „Da kommt jeden Tag ein Anruf und man soll von einer Stunde auf die andere eine Familie parat haben, die bereit ist für ein Interview oder eine Fotosession. Da soll man dann immer zaubern.“
Den Rest des Jahres sei das Interesse der Medien gering, obwohl es viele brennende Themen gäbe: etwa die Forderung nach einem Schulbesuch über das zehnte Schuljahr hinaus oder die Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Down-Syndrom. „Zum Welt-Down-Syndrom Tag gibt es kurz Berichterstattung, dann ist es wieder vorbei. Und es geht vor allem nie in die Tiefe“, sagt Andrich.
Gedenktage wie den Welt-Down-Syndrom-Tag gibt es viele: Weltfrauentag, Welt-Autismus-Tag oder Welttag der Pressefreiheit. Sie alle bieten Anlass, über gesellschaftlich relevante Themen zu berichten. Die Vereinten Nationen rufen seit 1947 zu Gedenktagen auf. Sie sollen laut Website „die internationale Aufmerksamkeit auf wichtige Themen lenken oder an historische Ereignisse erinnern“.
Alles für die Reichweite?
Auch wenn durch solche Tage gesellschaftlich relevante Themen kurzfristig Sichtbarkeit erlangen: In Zeiten der Social-Media-Logik bleibt ein bitterer Beigeschmack. Wenn es Redaktionen nämlich nur um das Erlangen von Reichweite geht, bleiben die wirklich wichtigen Themen meist unter dem Radar. Das sei aber nicht nur bei Jahrestagen so, sondern generell ein Problem des Nachrichtenjournalismus, wie die Journalistin Barbara Maas, die auch als Trainerin und Coach tätig ist, sagt: „Ich finde Nachrichten nach wie vor sehr wichtig, aber man gerät als Journalist*in schnell in ein Hamsterrad. Wir jagen Nachrichten hinterher, es passiert immer etwas. Das strengt an und erzeugt ein Gefühl von: Wir haben gar keine Zeit mehr, uns wirklich um Themen zu kümmern.“
„Gerade wenn der Journalismus weiter einen Mehrwert in demokratischen Prozessen bieten will, muss er sich selbstkritisch fragen, was er dafür tun kann, dass Leute sich für wichtige Dinge in ihrem Leben interessieren, ohne sie komplett auszulaugen.“ Barbara Maas, Journalistin
Hier kommt konstruktiver Journalismus in Spiel. Zwar erzeugen Gedenktage eine „künstliche Aktualität“, doch daraus ließen sich gute Geschichten entwickeln, sagt Maas. Nämlich dann, wenn Redaktionen sich fragen: „Können wir das Thema aus einer anderen Perspektive anschauen? Was sind die Probleme, können wir Lösungen dafür suchen? Gibt es Hintergründe, über die wir noch nie gesprochen haben? Können wir jemanden fragen, mit dem wir noch nie zu diesem Thema gesprochen haben, der vielleicht Teil einer marginalisierten Gruppe ist?“
Das „Clickbait-Desaster“: Konsument*innen zurückgewinnen
Dass es Medien guttäte, die eigene Arbeitsweise zu reflektieren, zeigt auch die Studienlage zur Nachrichtenvermeidung. Laut Reuters Digital News Report 2024 vermeiden 39 Prozent der Befragten aus 47 Ländern manchmal oder oft Nachrichten, 2017 lag der Wert noch bei 29 Prozent. Immer mehr Menschen fühlen sich zudem von der Menge an Informationen überfordert: ebenfalls 39 Prozent der Befragten. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 28 Prozent. Darauf müsse der Journalismus reagieren, findet Maas: „Gerade wenn der Journalismus weiter einen Mehrwert in demokratischen Prozessen bieten will, muss er sich selbstkritisch fragen, was er dafür tun kann, dass Leute sich für wichtige Dinge in ihrem Leben interessieren, ohne sie komplett auszulaugen.“
In den vergangenen zehn Jahren lag der Fokus auf der Social-Media-Reichweite. Das habe zu einem Vertrauensverlust geführt. Die Journalistin nennt das das „Clickbait-Desaster“: „Weil das Versprechen aus der Headline ganz oft nicht gehalten wurde.“
Reichweite allein reiche nicht mehr, um Konsument*innen zu erreichen. Gerade in Hinblick auf Abo- oder Mitgliedschafts-Modelle, sei eine langfristige Vertrauensbeziehung entscheidend. „Wenn ich für ein Abo bezahle, frage ich mich: bin ich informativ gut aufgehoben? Passt das zu meinen Werten? Arbeiten die journalistisch ordentlich?“
Fragen, die nicht für alle gleich leicht zu beantworten sind. Stichwort Media Literacy, also Medienkompetenz. Maas findet, Plattformen wie TikTok würden es viel schwerer machen, Quellen zu überprüfen. Hier brauche es mehr Aufklärung schon an Schulen sowie eine bessere Ausbildung von Lehrer*innen. Denn Menschen mit hoher Medienkompetenz könnten gezielter entscheiden, welche Nachrichten für sie wichtig sind.
Empathie statt Dauerberieselung
Es reiche aber nicht, die Last der Verantwortung für einen sinnvollen Medienkonsum den Nutzer*innen aufzuerlegen, auch Medien seien gefragt, ihren Teil zu leisten. Maas plädiert für mehr Empathie im Journalismus: „Journalist*innen haben oft das Gefühl, sie machen etwas Gutes für die Demokratie, weil sie Menschen informieren.“ Sie würden sich dann bei belastenden Ereignissen weniger hilflos fühlen – schließlich gebe es etwas zu tun“. Die Journalistin ergänzt: „Das Gemeine ist aber: Alle anderen, die sich unsere Berichterstattung anschauen, müssen in dieser Hilflosigkeit verharren.“ Eine zentrale Frage in Redaktionen müsse laut Maas daher sein: „Was macht das eigentlich mit den Menschen?“
Ein persönlicher Schlüsselmoment war für Maas der Terroranschlag im Pariser Bataclan. An dem Tag hatte Maas, die zu dem Zeitpunkt in einer Nachrichtenredaktion tätig war, einen freien Tag und verfolgte die Berichterstattung als Konsumentin. Neben dem laufenden Fernseher las sie gleich mehrere Nachrichtenseiten mit Live-Tickern, ohne Pause, stundenlang. Mit allen emotionalen Auswirkungen. Am Ende war es das Foto eines blutigen T-Shirts, das sie zum Abdrehen und Umdenken gebracht hat: „Ich fühlte mich ängstlich und überfordert. Ich dachte: Das bringt mir jetzt gar nichts, dass ich dieses Foto gesehen habe.“
Ein bisschen mehr Ruhe und Tiefgang
Hier sieht Maas schon jetzt eine positive Entwicklung im Umgang mit heiklen Themen: „Es gibt schon mehr Achtsamkeit und ein Bewusstsein dafür, dass man Leuten nicht immer alles zumuten kann.“
„Ich habe den Eindruck, dass es den Wunsch gibt, sowohl bei den Leuten, die Journalismus konsumieren, als auch bei denen, die ihn machen, nach ein bisschen mehr Ruhe und Beständigkeit, ein bisschen mehr Erklären und weniger hinterherjagen.“ Am Ende, sagt Maas, sei konstruktiver Journalismus vor allem eins: „Journalismus, der sehr viel stärker wahrnimmt, dass die, die Journalismus machen und die, die Journalismus konsumieren, auch Menschen sind. Ich glaube, wenn man das in den Mittelpunkt stellt, hilft es, Dinge besser zu machen.“