

Inside Sellners Trollfabrik
Wie Rechtsextreme versuchen Meinungsumfragen bei österreichischen Onlinemedien zu beeinflussen

Die Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel sprach es vor wenigen Tagen auf X, vormals Twitter, an: „Wie geht ihr jetzt mit Freundinnen um die in eine komplette Antisemitismus Rabbithole gefallen sind?“.
Die Antworten zeigten, wie sehr das Thema gerade viele Menschen umtreibt. Die Reaktionen auf den Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober und die militärische Antwort Israels, haben erneut gezeigt, wie verbreitet Antisemitismus ist. Auch in progressiven Milieus.
Wie schon bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie ist gerade hautnah zu erleben, wie sich Menschen radikalisieren. Was dagegen unternommen werden kann, erklärt Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus, im Gespräch.
tag eins: Woran erkennt man eine Radikalisierung von Personen?
Verena Fabris: Es gibt weder eine Checkliste noch so etwas wie eine extremistische Persönlichkeit. Jede Radikalisierungsgeschichte muss individuell betrachtet werden und extremistische Aussagen oder Tathandlungen müssen in einen historischen, politischen und sozialen Kontext gesetzt werden. In der Beratungspraxis ist für uns die Akzeptanz von Gewalt und in Folge die Gewaltbereitschaft ein Gradmesser, ebenso wie das Vertreten von Ungleichheitsvorstellungen und die damit verbundene Abwertung anderer Menschengruppen.
Auch eine Verengung des Blickwinkels, ___STEADY_PAYWALL___ ein Absolutheitsanspruch der eigenen Anschauung, ein sich Verschließen gegenüber Kritik und anderen Meinungen sind Anzeichen für einen fortschreitenden Radikalisierungsprozess. Weitere Elemente sind: Verschwörungsdenken, das Identifizieren von Sündenböcken und eine gesellschaftliche Polarisierung; „Wir“ gegen „Die“, „Die da oben“ – „Wir da unten“.
Was kann eine Radikalisierung auslösen?
Die Auslöser für eine Radikalisierung sind vielfältig und liegen sowohl in der eigenen Persönlichkeit als auch im sozialen Umfeld sowie gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Auf der individuellen Ebene steht zu Beginn meistens ein Unmutsgefühl, die Wut nicht dazu zu gehören, nicht gehört zu werden und oft auch – so paradox das klingen mag – der Wunsch nach Gerechtigkeit. Brüche in der eigenen Biographie, wie der Verlust von Bezugspersonen, instabile Familienverhältnisse, das Scheitern an Leistungsansprüchen oder Diskriminierungserfahrungen können Radikalisierungsprozesse beschleunigen.
„Förderlich ist weder eine Bagatellisierung, wie wir sie in der Beratungspraxis immer wieder bei als rechtsextrem wahrgenommenen Aussagen beobachten, noch ein Über-Alarmismus, wie er uns eher beim Verdacht auf eine islamistische Radikalisierung begegnet.“
Wie wichtig ist dabei das Umfeld? Die Freund*innen?
Das soziale Umfeld, die Peergruppe oder auch die Social-Media-Bubble, in der sich jemand bewegt, spielen eine bedeutende Rolle: In der Gruppe finden Personen, die sich radikalisieren, Gehör, Anerkennung und Wertschätzung. Auf der Ebene der Ideologie geht es um einfache Antworten auf komplexe Fragen, um Sinnsuche und Orientierung.
Auf der Ebene der Gesellschaft geht es um Ungleichheit: um den tatsächlichen oder vermeintlichen Ausschluss von bestimmten Gruppen oder auch um eine ungerechte Verteilung von Ressourcen. Globale Konflikte können als Mobilisierungspotential für die extremistische Ideologie fungieren, indem dazu aufgefordert wird, sich gegen Unterdrückung zu wehren. Etwa gegen den von Rechten suggerierten „Bevölkerungsaustausch“ oder gegen den „Kampf des Westens gegen den Islam“, um nur zwei Opfernarrative zu nennen.
Wie soll das Umfeld darauf reagieren?
Förderlich ist weder eine Bagatellisierung, wie wir sie in der Beratungspraxis immer wieder bei als rechtsextrem wahrgenommenen Aussagen beobachten, noch ein Über-Alarmismus, wie er uns eher beim Verdacht auf eine islamistische Radikalisierung begegnet.
Zunächst gilt es, mit dem Gegenüber in Kontakt zu bleiben, nachzufragen, Interesse zu zeigen. Hilfreich ist es, hierbei klar zu trennen zwischen der Person und ihrem Verhalten. Das Gegenüber als Mensch mit Wünschen und Bedürfnissen anzuerkennen, heißt jedoch nicht, für alles Verständnis zu zeigen. Im Gegenteil ist es zentral, den eigenen Standpunkt klar zu machen und sich eindeutig gegen Abwertungen und gegen Gewalt zu positionieren.
„Denn als Angehörige und Freund*innen sind wir oft ein letztes Fenster zu einer anderen Welt.“
Normalerweise fällt eine Radikalisierung nicht nur einer Person auf.
Wichtig ist es, bevor Schlüsse gezogen werden, mit den betreffenden Personen selbst zu sprechen, aber auch mit Personen aus deren Umfeld: Was ist anderen aufgefallen? Wie hat sich die Person verändert? Was könnten Gründe für diese Veränderung sein? Sich Rat von außen zu holen, ist in jedem Fall nicht verkehrt. Bei der Beratungsstelle Extremismus ist eine vertrauliche, anonyme Beratung möglich.
Was soll auf keinen Fall gemacht werden?
Was selten hilft, ist der Versuch mit rationalen Argumenten dagegen zu halten. Vielmehr geht es darum, emotionale Prozesse hinter der Radikalisierung nachzuvollziehen und die betroffene Person dabei zu unterstützen, alternative Perspektiven für sich zu erkennen. Solange mir die Person am Herzen liegt, ist ein kompletter Beziehungsabbruch hinderlich. Denn als Angehörige und Freund*innen sind wir oft ein letztes Fenster zu einer anderen Welt. Wenn das Fenster auch nur einen Spalt breit offen bleibt, hat die betroffene Person in Zeiten des Zweifelns die Möglichkeit einen Schritt auf uns zu zumachen. Eine Ausnahme stellen Selbst- und Fremdgefährdung dar.
Nur mit deiner Unterstützung, deinem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag, können wir unabhängig recherchieren und sorgfältigen Journalismus machen.
Jetzt Mitglied werden

Wie Rechtsextreme versuchen Meinungsumfragen bei österreichischen Onlinemedien zu beeinflussen


Madeleine Petrovic will mit einer Mischung aus Corona-Leugnung, Russland-Freundlichkeit und Transfeindlichkeit in den Nationalrat kommen. Anders als vermutet, wird der Antritt der ehemaligen Grün-Politikerin den Grünen nicht schaden.


Schnelle Lösungen passen scheinbar gut in unsere Zeit. Doch komplexe Probleme lassen sich nicht einfach lösen. Um den Kampf gegen die extreme Rechte nicht zu verlieren, müssen demokratische Entscheidungen schneller werden.


Anfang Juli wurde ein 21-jähriger Wiener zu einer Haftstrafe verurteilt: Er war Mitglied der „Feuerkriegs Division“, einer besonders gewaltbereiten, internationalen Neonazi-Organisation. Der Rechtsextremismus-Experte Florian Zeller erklärt die Hintergründe.
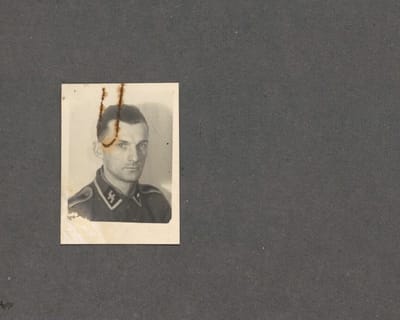

Bis heute distanziert sich die FPÖ nicht von der SS. tag eins hat exklusiv Einblick in die SS-Akten von ehemaligen FPÖ-Parteichefs und Gründungsmitgliedern genommen.


In der Affäre Ott tauchen Politiker der FPÖ immer wieder an zentralen Stellen auf. Ihre Rolle wurde bis jetzt zu wenig beleuchtet – ebenso wie Otts Interesse an antifaschistischen Aktivist*innen.