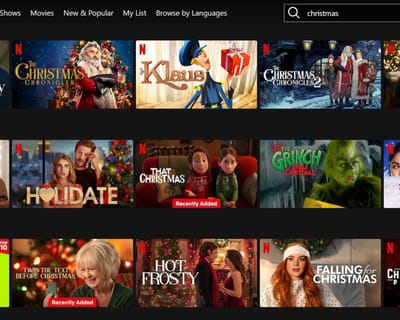„Sich Nachrichten bewusst zu entziehen, ist eine Kompetenz“
tag eins: Pandemie, Inflation, Krieg, Terror – momentan ist es kaum möglich, negativen Nachrichten zu entweichen. War das früher anders?
Tobias Dienlin: Krisen gibt es seit Beginn der Menschheit. Die Wahrscheinlichkeit, aufgrund kriegerischer und gewalttätiger Ereignisse zu sterben, war noch nie so gering wie aktuell. Auch wenn sich das subjektiv anders anfühlt. Früher gab es auch Tageszeitungen, die Abendausgabe und das Extrablatt – oder Dauernachrichtensendungen, etwa bei 9/11, als alle vor dem Fernseher gesessen sind. Medien spielen schon lange eine zentrale Rolle in der Rezeption der Nachrichten. Neu ist aber, dass wir an Ereignissen, die am anderen Ende der Welt stattfinden, live teilhaben können und in das sogenannte „Doomscrolling“, also das exzessive Konsumieren negativer Nachrichten im Internet verfallen können.
Warum ziehen uns negative Nachrichten denn so an?
„Bad news are good news“ – das war auch schon vor Social Media so. Dass wir auf negative Nachrichten stärker reagieren als auf positive, hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe. Gerade wenn Krisen beginnen, ist es extrem wichtig für uns, zu wissen, wie relevant die Ereignisse sind und was jetzt zu tun ist, um Gefahren abzuwenden. So war das beispielsweise zu Beginn der Covid-19-Pandemie. Das nützen Medien auch aus.
Tobias Dienlin befasst sich an der Universität Wien mit interaktiver Kommunikation und der Frage, wie sich Social Media auf die psychische Gesundheit auswirkt. In seinem Blog bemüht er sich, Wissenschaft offen zugänglich zu machen.
Wer direkt betroffen ist, etwa in Zeiten der Pandemie, muss sich informieren. Das ist verständlich. Bei anderen Ereignissen – wie dem aktuellen Krieg in Nahost – besteht für Personen, die nicht dort leben, kein akuter Handlungsbedarf. Warum kann man auch dann oft nicht abschalten?
Dinge, die geografisch, psychologisch oder unsere Identität betreffend näher an unserer Lebenswelt dran sind, tangieren uns mehr als andere. Der Nahostkonflikt hat auch im deutschsprachigen Raum eine wichtige historische Bedeutung. Das löst bei uns viel aus. Interessant sind auch die Präsidentschaftswahlen in den USA, die uns im deutschsprachigen Raum immer sehr beschäftigen, obwohl sie am anderen Ende der Welt stattfinden und uns eigentlich egal sein könnten. Aber sie sind für uns nah, weil die USA in vielerlei Hinsicht Vorreiterin ist. Die Dinge, die dort passieren, kommen später oft auch zu uns.
„Sind es die Medien, die mich unglücklich machen oder das Ereignis, über das die Medien berichten?“
Viele Themen, die uns beschäftigen, lösen oft Stress, Angst und Trauer aus. Hat das längerfristige Folgen?
Man muss keine Angst haben, ___STEADY_PAYWALL___dass die Auswirkungen des Medienkonsums einen komplett umkrempeln und zu einer neurotischen Person machen, dass man ängstlich wird und nichts mehr auf die Reihe kriegt. Das ist häufig Panikmache, in den allermeisten Fällen haben Medien nicht diese Wirkung auf uns.
Doch diese vielen kleinen Nutzungsepisoden, in denen wir immer wieder den gleichen negativen Effekt empfinden, beinflussen uns doch ein wenig. Da kann es sinnvoll sein, den eigenen Medienkonsum kritisch zu hinterfragen und auch mal zu sagen: Okay, jetzt ist es aber gut, jetzt leg ich das Handy weg, sperre es vielleicht sogar physisch weg, weil ich sonst meiner Arbeit heute nicht mehr nachkommen kann. Ich persönlich habe bei gewissen Events auch schon gesagt: Okay, das ist jetzt so relevant und disruptiv, heute schaff ich es eben nicht mehr zu arbeiten – beim Sturm aufs Kapitol Anfang 2021 zum Beispiel. Man muss nicht immer nur eine produzierende Maschine sein.
Was bedeutet das, wenn ich das jeden Tag erlebe? Kann ich davon depressiv werden? Kann ich davon eine Angststörung entwickeln?
Nein, das ist zu hoch gegriffen. Auf einer Gefühlsebene spüren wir den Medieneffekt natürlich, wenn mich ein Katzenvideo zum Lachen bringt, genauso wie wenn ich erschütternde Bilder aus Israel sehe. Deswegen entwickle ich aber nicht gleich eine Angststörung oder werde depressiv. Bei manchen Menschen stellt die Mediennutzung zwar ein substanzielles Problem dar, aber psychologische Erkrankungen sind in der Regel multifaktoriell bedingt. Da spielen viele Einflüsse und Dispositionen eine Rolle. Medien werden da oft zum Sündenbock. Denn sind es die Medien, die mich unglücklich machen oder das Ereignis, über das die Medien berichten? Gerade in der Corona-Pandemie haben das viele nicht auseinandergehalten: Was gerade passiert, ist schlimm, aber das liegt vielleicht nicht an den Medien, sondern einfach an der Pandemie.
„Wenn ich bereits viele Sorgen habe, können mich die Nachrichten auf Social Media umso mehr belasten.“
In den letzten Jahren sind die Zahlen von Menschen, die psychisch belastet oder gar psychisch erkrankt sind, massiv angestiegen. Sind Personen, die schon vorbelastet sind, nicht vielleicht doch umso belasteter von negativen Nachrichten?
Ja, das kann man sagen. Das ist das Matthäus-Prinzip: Diejenigen, die haben, denen wird gegeben und denjenigen, denen es mangelt, wird alles genommen. Wenn man beispielsweise einen hohen Selbstwert hat, machen die schönen Bilder auf Instagram nicht so viel mit einem. Wenn ich eher unsicher bin, fordern mich diese ganze Schönheit und Erfolgsgeschichten viel mehr heraus. Wenn ich bereits viele Sorgen habe, können mich die Nachrichten auf Social Media umso mehr belasten.
Wie kann man verantwortungsbewusst Nachrichten konsumieren, ohne die negativen Effekte zu stark zu spüren?
In einer Demokratie ist es natürlich ein Stück weit Verantwortung der Bürger*innen, sich zu informieren und hochqualitative Quellen zu nutzen. Nur weil gewisse Verhaltensweisen auch negative Konsequenzen haben, heißt das nicht, dass das Verhalten falsch ist. Wir haben durch die Mediennutzung den Vorteil einer besseren Informiertheit. Selbst das Empfinden von Leid kann sinnvoll sein, weil es sensibilisieren und motivieren kann, sich für etwas einzusetzen. Zu einem ganzheitlichen Weltbild gehört es auch, diese Gefühle aushalten zu können. Aber es ist natürlich vollkommen legitim, zu sagen: Jetzt ist es mir zu viel, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich schaffe es jetzt nicht mehr. Sich bewusst zu entziehen, das Handy wegzulegen und sich dabei nicht schlecht zu fühlen, ist eine Kompetenz.
„Medienunternehmen in der Häufigkeit ihrer Posts zu regulieren, wäre ein krasser Einschnitt in die Pressefreiheit.“
Die Möglichkeit, das Handy wegzulegen oder sich einen Tag lang nur mit Nachrichten zu befassen und nicht zu arbeiten, ist ein Privileg, das nicht jede*r hat. Gibt es weitere Strategien, die man anwenden kann, um nicht automatisch wieder zum Handy zu greifen und sofort das nächste erschütternde Video zu sehen?
Es ist sinnvoll, automatische Pull-Faktoren, wie Notifications für Apps wie Instagram oder Twitter, zu reduzieren oder auszuschalten. So mache ich es selbst. Ich nütze gerne Social Media, aber ich entscheide mich so gut es geht stets bewusst, eine App zu öffnen. Ich kann auch bestimmte Channels einfach mal für ein paar Tage auf mute stellen und so meinen eigenen Feed kuratieren. Es gibt beispielsweise Apps, die Zeitbeschränkungen einführen oder Content Blocking, durch das gewisse Inhalte nicht mehr ausgespielt werden. Man kann die Nutzung über bestimmte Tools, Einstellungen und Apps unattraktiver machen, indem beispielsweise der Bildschirm nur noch in schwarz-weiß angezeigt wird.
Gleichzeitig ist mehr als die Hälfte der jungen Menschen psychisch belastet und die Zahlen steigen immer noch. Kann man dann die Verantwortung über den Medienkonsum allein diesen Individuen zuschieben oder gibt es die Möglichkeit, diesen zu regulieren, etwa durch Triggerwarnungen oder Beschränkungen der geposteten Bilder?Diese Regulierung ist eine schwierige, offene Frage, und ein relevantes aktuelles Forschungsthema. Es gibt viele sinnvolle Richtlinien, die man anwenden kann, wie etwa Triggerwarnungen. Man könnte Altersgrenzen anheben oder Medienkompetenzprogramme flächendeckend in den Bildungssektor implementieren. Aber Medienunternehmen in der Häufigkeit ihrer Posts zu regulieren, wäre ein krasser Einschnitt in die Pressefreiheit. Das ist ein Dilemma, denn kein Unternehmen möchte freiwillig weniger von einem Dienst verkaufen, von dem es profitiert. Gleichzeitig ist es für die Unternehmen auch nachhaltiger, wenn sich Konsument*innen bei ihnen wohlfühlen und nicht nach einer Weile merken, dass ihnen das Angebot nicht gut tut.
Jana Reininger ist freie Journalistin in Wien und Gründerin von
ZIMT - Das Magazin für die Psyche. Neben ihrem Ziel, Wissen über die Psyche für alle zugänglich zu machen, schreibt sie über soziale Ungleichheit und beforscht an der Universität Wien Stadt und Migration.